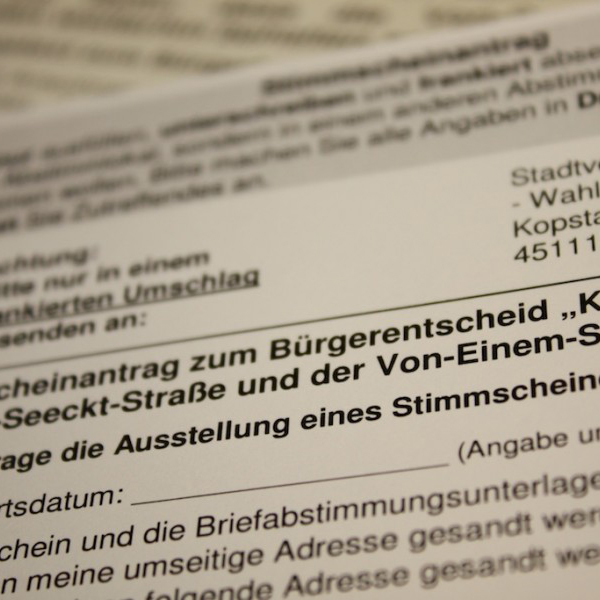Ein befreundeter Architekt aus Bochum hat mir einmal sinngemäß gesagt: „Altstadt hat für mich nichts mit Fachwerkhäusern und engen Gässchen zu tun. Zur Altstadt gehören für mich Einkaufsstraßen, Leuchtreklame und die Gebäude der 50er Jahre.“ Eine typische westdeutsche Nachkriegsinnenstadt also: Verwelkte Wirtschaftswunderzeit, Häuser, irgendwie alt, aber nicht so richtig. Teilweise ungelenke Chimären aus einer „richtigen“ Altstadt und den Ideen einer modernen City. Unscheinbar aber seltsam faszinierend, wenn man einmal genauer hinschaut. Ich habe das hier ja auch schon ein oder zwei Mal getan.
Ganz, ganz genau hingesehen hat Benedict Boucsein im Rahmen seiner Dissertation an der ETH Zürich. In dem daraus entstandenen Buch „Graue Architektur – Bauen im Westdeutschland der Nachkriegszeit“ beschäftigt er sich – oder besser: erzählt er die Geschichte zweier unscheinbarer Gebäude in der Essener Innenstadt und verwebt Baugeschichte mit der Geschichte der beteiligten Personen. Da geht es um die wirtschaftlichen Interessen des Bauherrenehepaars, die Überforderung der unterbesetzten Essener Stadtverwaltung unter ihrem Stadtbaurat Sturm Kegel und natürlich um die Arbeit der beteiligten Baumeister und Architekten.
Ich habe das Buch fast am Stück verschlungen. Der Inhalt rumorte einige Zeit in meinem Kopf, dann habe ich Benedict Boucsein kontaktiert und mit ihm ein Interview geführt. Der Text erscheint Anfang 2013 in einer Publikation zum 60-jährigen Jubiläum des BDB Landesverbandes Rheinland-Pfalz. Ein Auszug will aber jetzt schon raus:
––––
Herr Boucsein, viele westdeutsche Großstädte, so auch Essen oder Koblenz, lagen Anfang der 1950er Jahre noch in Trümmern. Wie ist man diese gewaltigen Bauaufgaben angegangen?
Die meisten deutschen Innenstädte wurden zu großen Teilen durch einzelne, private Bauherren wiederaufgebaut, und zwar Grundstück für Grundstück. Die entsprechenden Bauherren hatten oft nur wenige Mittel zur Verfügung. Gleichzeitig drängte die Zeit aufgrund der enormen Wohnungsnot. Die von ihnen beauftragten Architekten und Baumeister scheinen die Aufgabe meist pragmatisch und mit Blick auf diese Lage der Bauherren angegangen zu sein. Auch betrachteten viele von ihnen die erste Wiederaufbauphase als durchaus provisorisch. Sie wollten die Stadt wieder in eine funktionierende und einigermaßen lebenswerte Umgebung verwandeln. Für Korrekturen war ja später immer noch Zeit. […]
Was haben uns die Baumeister der Nachkriegszeit hinterlassen?
Mehr, als wir im Moment meinen. Als ich mich mit der Zeit nach 1945 auseinandergesetzt habe, ist mir aufgefallen, wie wenig man damals die Gebäude der Gründerzeit geschätzt hat. Man hätte die entsprechenden Quartiere am liebsten ganz abgerissen. Heute sind wir mit Vierteln aus der Nachkriegszeit konfrontiert und spüren den gleichen Impuls. Gerade aber in den Innenstädten finden wir oft eine einzigartige Umgebung, die wie die Gründerzeitquartiere auch in einem Schub entstanden ist.
Also doch kein Provisorium wie von den Erbauern gedacht?
Ich bin der festen Überzeugung, dass die Stadt der Baumeister in einigen Jahren eine Renaissance erleben wird. Und über manchen Abriss und über manche Veränderung wird man sich dann genauso ärgern, wie man das heute in Hinsicht auf die Stadt der Gründerzeit tut. Natürlich sind Qualität von Bauweise und Grundrissen aus heutiger Sicht nicht mit der Gründerzeit vergleichbar. Die Geschichte lehrt uns aber, dass wir den Qualitäten dessen, was wir als selbstverständlich und „alt“ betrachten, blind gegenüberstehen, und deshalb sollten wir sehr vorsichtig sein und sowohl die Leistung der Baumeister als auch ihre Architektursprache respektieren und weiterführen.
P.S.: Der Text ist für Rheinland-Pfalz bestimmt, die Bilder sind dementsprechend aus Koblenz. Das „Haus des Straßenverkehrs“ verstehe ich durchaus als Gegenentwurf zu „Stadt der Baumeister“. Darüber hat sich auch Prof. Herrmanns von der FH Koblenz in seinem Blog schon geäußert.